Karla Turners Taken: Inside the Alien-Human Agenda (1994)
Grenzwissenschaft
Karla Turners Taken: Inside the Alien-Human Agenda (1994)
Von Chris Dimperl
Karla Turner legt in Taken kein weiteres Entführungs-„Fallbuch“ vor, sondern ein Stück Gegenwartsdiagnose: Acht Frauen aus verschiedenen US-Bundesstaaten erzählen ihr Leben unter einem Druck, der gleichermaßen physisch, psychisch und sozial wirkt – und Turner nimmt diese Erzählungen beim Wort. Statt mit Hypnosesitzungen den Plot zu glätten, betont sie das Fragmentarische, die Lücken, die Verschiebungen, die späteren Einsichten; gerade dadurch entsteht die eigentümliche Intensität dieses Buchs. Den Rahmen setzen bereits Vorwort und Inhaltsübersicht: Es geht um eine Neudefinition des Phänomens, um die vergleichende Sicht auf Motive, Spuren, Orte und Nachwirkungen, um die Erweiterung des Blicks – und zuletzt um eine kontroverse Rundtisch-Diskussion der Forschungscommunity. Der Aufbau ist bezeichnend nüchtern: nach dem Prolog folgen die Kapitel „Redefinition“, die acht Fallporträts Pat, Polly, Lisa, Anita, Beth, Jane, Angie, Amy, ein Vergleichsschema, sodann „Expanding the View“ und „The Round Table“. Schon diese Dramaturgie verrät die Absicht: nicht „der“ große Fall, sondern eine Musterkarte sich wiederholender, aber immer wieder neu getarnter Eingriffe in die Lebenswirklichkeit der Betroffenen.
Mit „Redefinition“ markiert Turner den Abstand zu klassischen UFO-Erwartungen. Weder Fotoarchive noch Landespuren noch Regierungsakten haben in Jahrzehnten eine belastbare „Enderklärung“ geliefert. Dagegen zeigt der systematische Blick auf Erfahrungsberichte ein erweitertes Spektrum: forcierte Mitnahmen, danach unvollständige Erinnerung, körperliche Markierungen wie Einstiche, „Scoop-Marks“, Hämatome, dreipunktige Muster, dazu Elektronikstörungen, Stimmen und Lichter im Haus, und – am heikelsten – Szenen, die wie inszenierte Realitäten funktionieren: Virtual-Reality-Szenarien (VRS), die sich mit vollem Sinneseindruck wie „wirkliche“ Räume anfühlen, während der Körper gelähmt auf einem Tisch liegt oder scheinbar unberührt im Bett. Turner schildert einen dreifach bezeugten VRS-Vorfall um eine blaue, elektrische Lichtsphäre, in der eine Zeugin bei vollem Bewusstsein festgehalten wird – eine Szene, die das „Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“ des gesamten Buchs scharfstellt.
Die acht Frauen stehen für acht Blickwinkel auf ein Kaleidoskop, das sich dennoch zu erkennbaren Linien ordnet. Pat eröffnet den Reigen mit einer Erinnerung an Indiana, 1954: kleine graue Wesen, eine orangefarbene Lichtkugel, Militär auf dem Hof, später eine Fahrt in eine unterirdische Anlage, in der eine als „asiatisch“ maskierte Gestalt mit grünlich-grauer, reptilischer Haut an ihr hantiert – und die beunruhigende Erkenntnis: „Die Männer, der Truck, das Gelände mögen menschlich sein; die, die mich anfassen, sind es nicht.“ Turners Darstellung notiert nüchtern die Nachwirkungen – eine verletzte Zehe, Punktmale, eine anhaltende schemenhafte Präsenz –, und Pat fragt sich, was es bedeutet, wenn nichtmenschliche und menschliche Akteure in einer Szene zusammenfallen.
Polly steht für die innere Seite der Agenda: Kindheitsszenen – eine schmale Gestalt vor dem Fenster, das Gefühl eines Implantats hinter dem Ohr –, später außergewöhnliche Bewusstseinsereignisse, auch religiöse und politische Visionen. Einschneidend ist ein Satz, der sie lebenslang verfolgt: „Alles verläuft nach Plan, alles ist im Zeitplan.“ Er taucht in sexualisierten Zwangssituationen wieder auf und verleiht den Begegnungen eine eisige Teleologie: Es gibt einen Plan, doch er hat mit ihrem Wohl nichts zu tun. Pollys Erwachsenwerden ist geprägt von der Suche nach Kontrolle: Distanz zu Beziehungen, Skepsis gegenüber den „Lehrern“ der anderen Seite, und zugleich das schwer zu lösende Paradox, dass man sich emotional an jene bindet, denen man intellektuell misstraut.
Lisa liefert das, was viele als „typisch“ ansehen – nur dass Turner zeigt, wie unzureichend das Wort ist. Da sind die Lichter im Haus, die Ohr- und Telefonstörungen, die fehlende Zeit, die Gyn-Prozeduren an Bord, aber auch Szenen, in denen menschliche Behörden ins Bild rücken: ein Verhör unter Nennung ihres Mädchennamens, eine Nacht mit visionären „Phönix-Vögeln“, die in einem plötzlichen Hochziehen gipfelt, woraufhin sie am nächsten Tag mit einer schweren Rückenverletzung aufwacht – ärztlich attestiert, womöglich dauerhaft. Bei Lisa wird spürbar, wie real die Folgen auch dann sind, wenn die Auslöser in Traum- oder VRS-Bereiche zu fließen scheinen.
Anita ist die „leise“ Fallgeschichte: seit der Kindheit ein Mann im roten Fliegeranzug, sporadische Besuche, und der Versuch, inneres Gleichgewicht zu halten – „nicht zu Göttern machen, nicht als Dämonen verabsolutieren“. Doch die nächtlichen Zaps, die Schatten, die plötzliche Müdigkeit lassen den Alltag brüchig werden; selbst wenn „nur“ eine schwarze, ein-dimensionale Maske kurz vor dem TV auftaucht, bleibt ein schmerzhafter Punkt an der Wirbelsäule zurück. Turners Stärke ist, diese Normalität im Ausnahmezustand literarisch nicht zu überhöhen – gerade dadurch wirkt sie plausibel.
Die restlichen Porträts Beth, Jane, Angie und Amy steigern den Befund, ohne ihn zu verzerren. Jane ist das Inventar körperlicher Spuren in Reinform, mit Dreipunkt-Mustern, Stanz- und Schürfmarken, teils in absurder Häufung. Beth schwankt zwischen „guten“ und „bösen“ Kräften; eine papierdünne Lichttür öffnet sich, aus der ein Besucher tritt – ein Motiv, das Turner mehrfach unabhängig notiert und so als serielles VRS-Requisit kenntlich macht. Angie führt mitten hinein in die MILAB-Debatte: Uniformierte, Hubschrauber, unterirdische Einrichtungen, Befragungen, Drohungen, parallel zu Begegnungen mit Nichtmenschen – hier verwischen die Kategorien. Und Amy erlebt eine der verstörendsten Szenen: In einem Raum mit Ex-Piloten, Militärs und Fachleuten entfernt eine maskierte Nichtmenschliche zwei Implantate (Ohr und vor allem tief im Spinalkanal) und erklärt, wie diese neurologische Kontrolle ausüben, bis hin zur vollständigen „Übernahme“ oder zum Tötungsakt; zugleich hört Amy von internen Fraktionen, die „Missbrauch“ stoppen wollen – eine seltene Einlassung in die Politik der Anderen.
Das Vergleichsschema bündelt, was der Leser längst ahnt: Diese Erlebnisse lassen sich nicht auf Zuchtprogramme reduzieren. Ja, es gibt die „Baby-Präsentationen“, die Begegnungen mit Hybriden, doch dieselben Frauen berichten ebenso von Levitationsszenen, Durchgang durch feste Materie, Telekinese, „Unterricht“ und Tests, von Gerätschaften an Bord und von Rückgriffen auf Lebensereignisse. Auffällig ist die Konstanz bestimmter Kulissen: die unterirdische Basis erscheint in mindestens der Hälfte der Fälle; in sieben Fällen sehen die Frauen andere Menschen in den Szenen, in sechs davon Militärpersonal. Turners Kommentar ist präzise: Es mag Forscher geben, die menschliche Kollaboration pauschal als Alien-Illusion deuten; doch ein bestätigter Gegenfall genügt, um die These zu kippen – und solche Indizketten liegen vor.
In „Expanding the View“ wagt Turner einen Blick auf die Langzeitwirkung. Nicht wenige Entführte berichten nach der Bewusstwerdung ihrer Erfahrungen von kognitiver Schärfung, Intuitionszuwachs, Naturverbundenheit. Paradiesische „Gaben“ sind das für Turner nicht; auffällig ist, dass dieser Zuwachs erst nach der bewussten Konfrontation auftritt – eher menschliche Anpassung an extremen Stress als pädagogische Wohltat der Besucher. Sie spielt mit kulturgeschichtlichen Bildern einer möglichen „Trikameralisierung“ des Geistes: Wenn eine Spezies unter massiven Druck gerät, entwickelt sie möglicherweise neue Wahrnehmungs- und Abwehrmechanismen; vielleicht ist das Erwachen vieler Abductees genau das – ein mentaler Gegenzug zu Täuschung und Kontrolle.
Die Technologie der Täuschung bleibt in Taken bewusst unterbestimmt; Turner protokolliert, was gesagt wird und was erlebt wird. Deutlich wird dennoch die Rolle der Implantate: Mal heißen sie Sensoren für „besondere Sinne“ und Boten eines Informationsaustauschs, mal Magnete für Daten, mal Instrumente zur Straf- und Totalkontrolle – ein Spektrum, das sich in keinem einfachen Bild fassen lässt. Genauso mehrdeutig bleibt die Hybrid-Linie: Die „Präsentationsrituale“ scheinen – so Pollys und Angies Eindruck – weniger Bindung an ein Kind zu erzeugen als die Mutter zu testen, ihre Schmerzgrenze auszumessen und ihre Loyalität zu prüfen. Das alles bildet den Hintergrund für Turners nüchterne, aber weitreichende Schlussfolgerung: Die Agenda berührt Fortpflanzung, Bewusstsein, Täuschungstechnologie und soziale Steuerung – und sie ist nicht die Agenda einer homogenen Gruppe.
Das Buch endet nicht mit einem Paukenschlag, sondern mit methodischer Aufrichtigkeit. In „The Round Table“ benennt Turner, was viele spüren: eine polarisierte Forschungslandschaft, in der ganze Komplexe – MILAB, unterirdische Einrichtungen, menschliche Mitwirkung – aus ideologischen Gründen ignoriert werden. Turner hält dagegen: Daten sind unbequem, aber sie sind da. Die vernünftigste Haltung ist eine doppelte Disziplin – weder alles glauben, noch alles verwerfen; weder die Betroffenen therapieren und danach klassifizieren, noch sie zu „Zeugen der Wahrheit“ verklären. Taken ist darum – bei aller Empathie für Trauma und Lebensbruch – vor allem ein Plädoyer für erkenntniskritische Offenheit: Die Grenze zwischen „außerirdisch“ und „irdisch“ ist nicht scharf zu ziehen, wenn Täuschung, Rollenwechsel und Kollaboration zum Spiel gehören. Was bleibt, ist ein klarer Blick auf Machtasymmetrien, auf das theatralische Moment der Begegnungen, auf die Notwendigkeit, Vergleich statt Lieblingshypothese zum Prinzip zu machen – und auf die Möglichkeit, dass gerade die Bewusstwerdung der Betroffenen der erste Gegenzug in diesem Spiel ist.
Forscher, Programmierer, Technikbegeistertes Mitglied des CCC - Chaos Computer Club: Bisher habe ich immer nur Wissen gesammelt. Gerade die Arbeit an UFOBase und Abductionbase habe Unmengen an Datenmaterial hervorgebracht. Auch meine kurze aber sehr intensive Arbeit bei MUFON-CES hat viele neue Erkenntnisse zu Tage gef├Ârdert. Hier nun m├Âchte ich einige dieser Geschichten und Daten weitergeben, so dass sie nicht in Vergessenheit geraten. Einige dieser Geschichten kann man nicht rationell erfassen oder mit den Mitteln unserer Wissenschaft greifen oder begreifbar machen. Es liegt an uns, was wir daraus machen. Wie sagte Mulder einst so sch├Ân? MULDER: Also, wenn uns die konventionelle Wissenschaft keine Antworten bietet, m├╝ssen wir uns dann am Ende nicht doch dem Fantastischen als M├Âglichkeit zuwenden? In diesem Sinne w├╝nsche ich Ihnen kurzweilige Stunden hier auf dieser Seite.
Wir verwenden keine externen Skripte - erst beim Klick öffnet sich der Dienst in einem neuen Fenster/Tab.


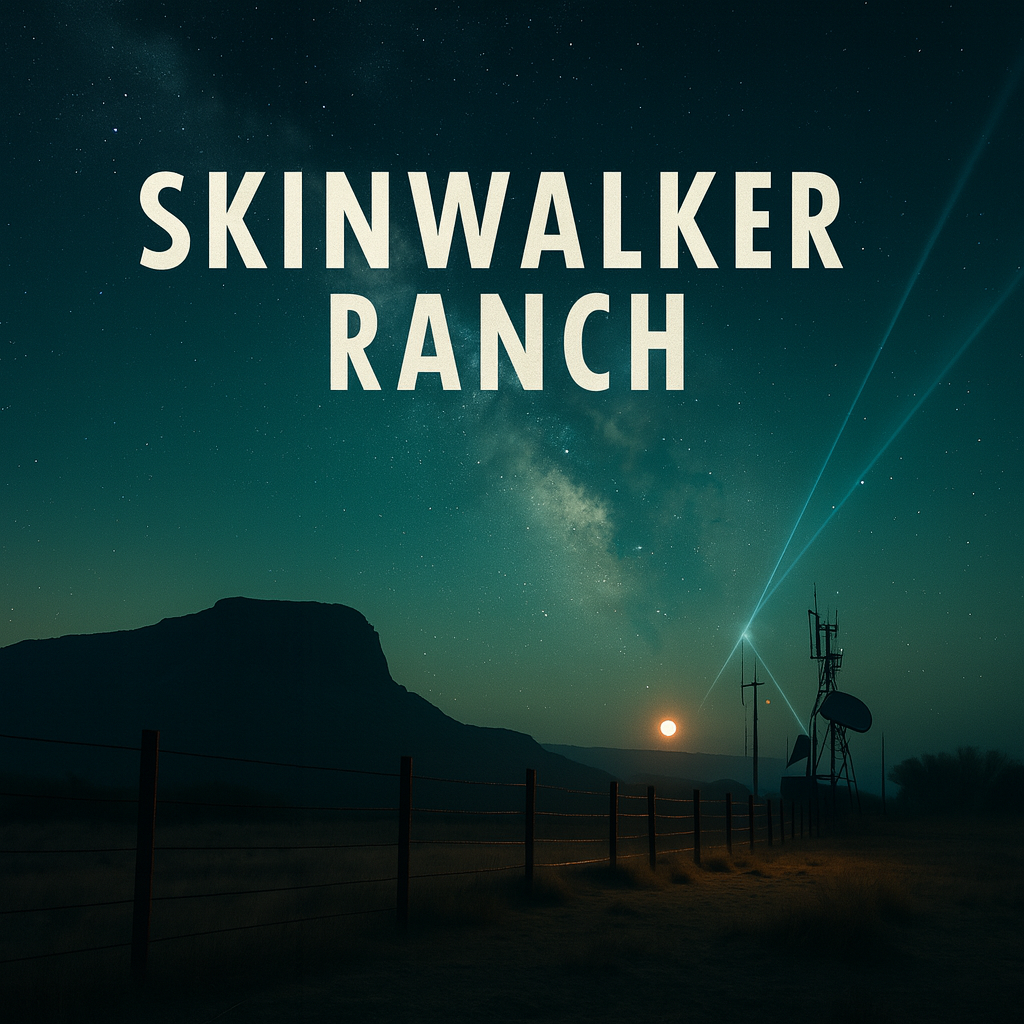
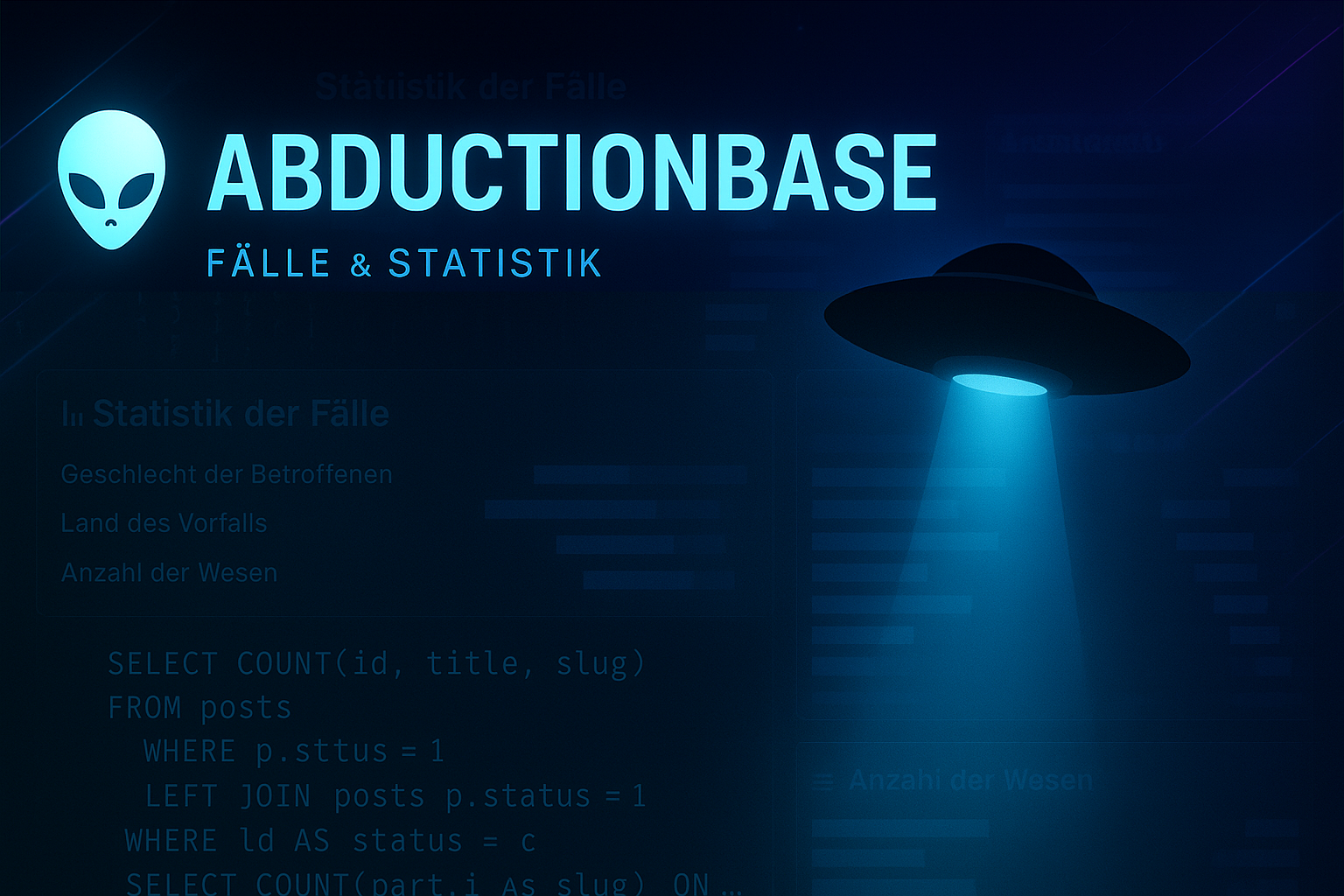
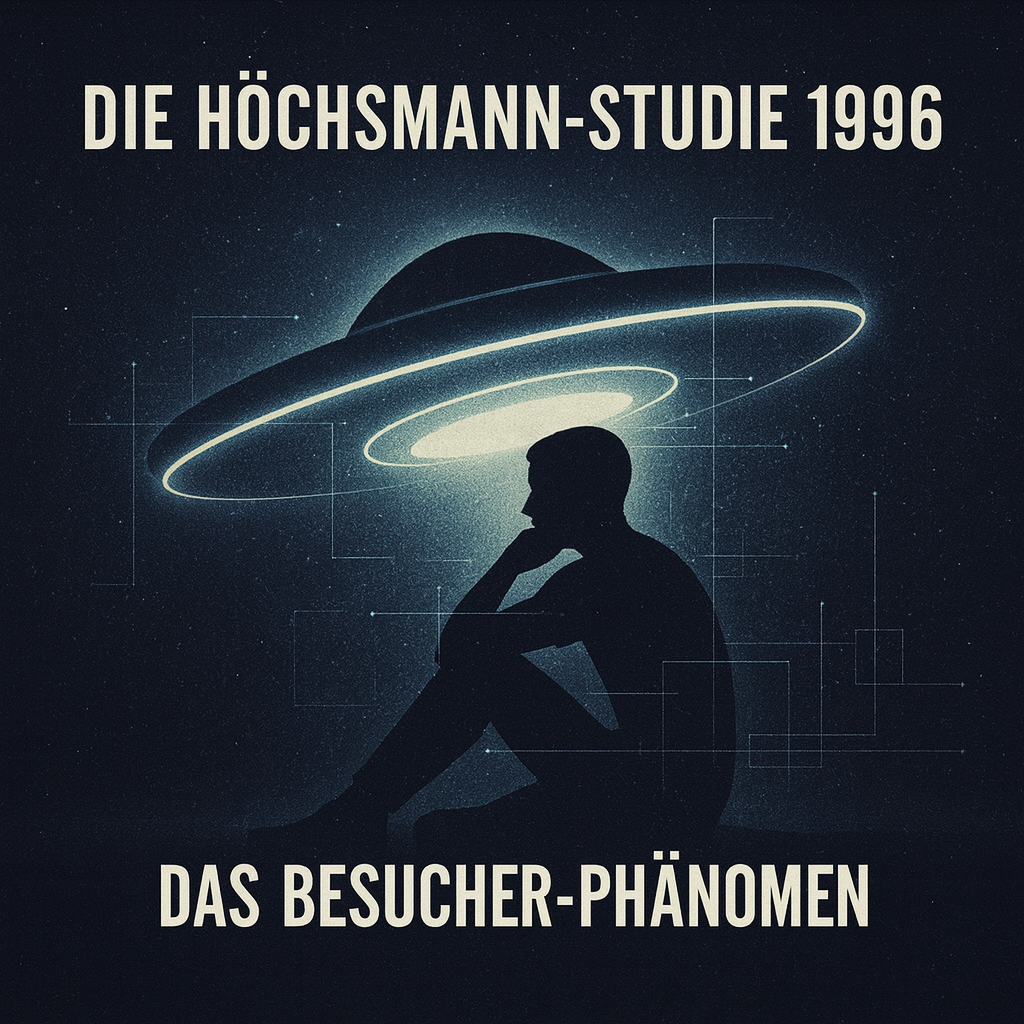
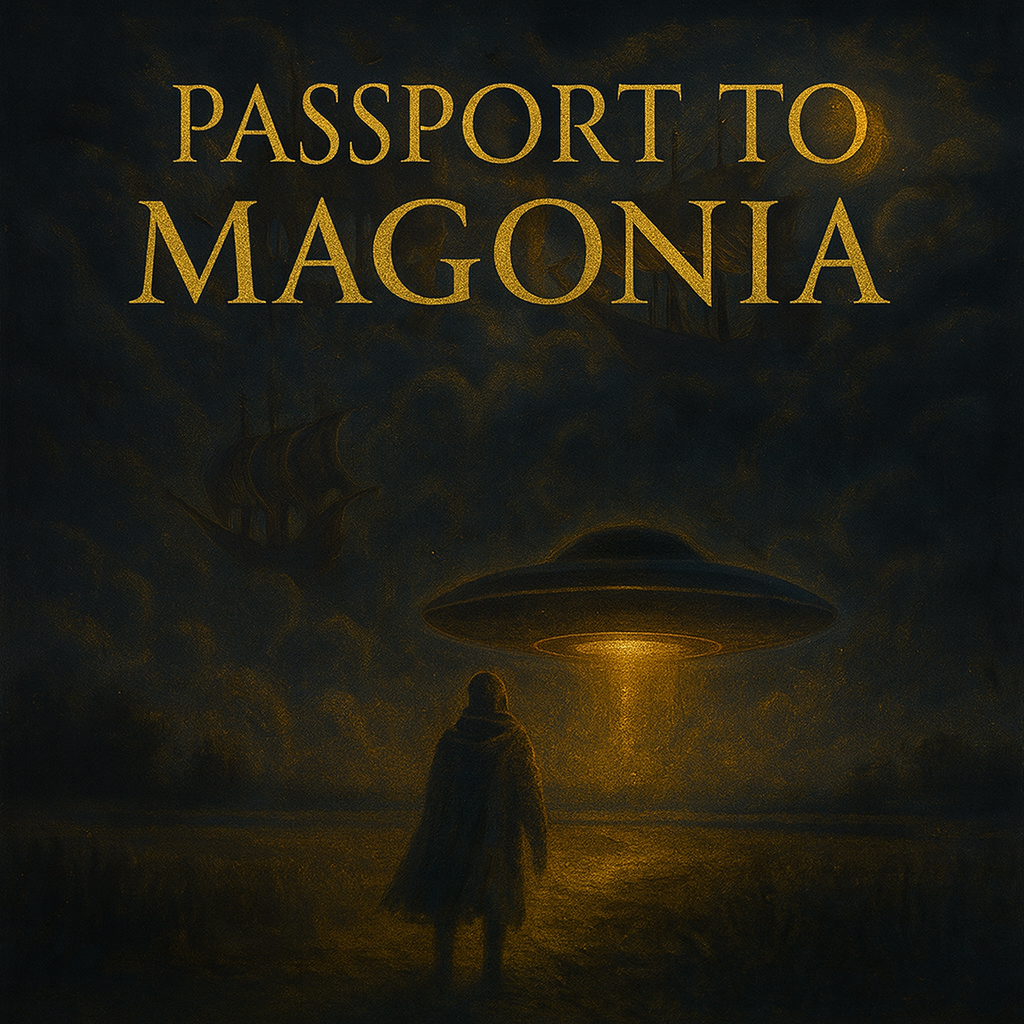
Kommentare